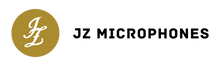Langweilige, aber wichtige Dinge leicht verständlich machen
Der Kauf eines Mikrofons ist ein bisschen wie der Kauf eines Autos. Wenn Sie kein erfahrener Technikfreak sind, wissen Sie wahrscheinlich nicht alles über die jeweilige Technologie, möchten aber zweifelsfrei sicher sein, dass Sie in ein Produkt investieren, das Ihren professionellen Anforderungen perfekt entspricht.
Tatsächlich kann der Kauf eines Mikrofons in manchen Fällen sogar mehr Verantwortung bedeuten. Dies gilt insbesondere, wenn Sie Ihr Geld mit der Aufnahme und Produktion von Musik verdienen (oder dies planen).
Die wichtigen Informationen stehen normalerweise im Datenblatt, aber wer hat schon die Zeit, das alles zu entschlüsseln, richtig?
Nun, das Ingenieurteam von JZ Microphones hat sich bereit erklärt, ein paar Hinweise mit Ihnen zu teilen. Lesen Sie sich ein und seien Sie besser informiert, wenn Sie Ihr erstes oder nächstes Mikrofon kaufen!
Wandlertyp
Ein Mikrofon ist selbst ein Wandler. Das bedeutet, dass es sich um ein Gerät handelt, das eine Energieform in eine andere umwandeln kann.
Diese Information steht normalerweise ganz oben im Datenblatt, denn wenn der Hersteller von Wandlertypen spricht, gibt er an, welche Technologie dieses Mikrofon verwendet, um den Ton einer beliebigen Quelle in ein elektrisches Signal umzuwandeln und es beispielsweise auf einem Laptop zu speichern, auf dem Ihre DAW installiert ist. Oder auf Band, wenn Sie so anspruchsvoll sind (gut für Sie).
Die Typen (derzeit) sind dynamisch, Kondensator (elektrostatisch) und Bändchen.
Ein Mikrofon mit dynamischer Kapsel besteht aus Membran, Magnet und Schwingspule. Letztere ist mit der Membran verbunden und von einem Magnetfeld umgeben. Die Bewegung der Schwingspule in der jeweiligen Umgebung (verursacht durch Gesang, Gitarrenspiel oder das Fallenlassen des Mikrofons) erzeugt ein elektrisches Signal, das die Schallwellen „interpretiert“ und bei Konzerten über die Lautsprecher ausstrahlt oder aufnimmt, wenn Sie ein dynamisches Mikrofon für die Aufnahme einer E-Gitarre verwenden, die über 4x12 gespielt wird.
Kondensatormikrofone sind für ihre hohe Schallempfindlichkeit und ihren breiten Frequenzbereich bekannt (mehr dazu später). Kondensatormikrofone nutzen einen Kondensator, der akustische Signale in elektrische Signale umwandelt. Er besteht aus zwei dicht aneinander hängenden Metallplatten, die unter Spannung stehen (Kapsel). Eine der Platten fungiert als Membran, die andere als Rückplatte.
Die Membran erkennt und reagiert auf geringfügige Veränderungen des Luftdrucks, die durch Schallwellen beim Sprechen, Singen oder Spielen entstehen. Außerdem verändert sich der Abstand zwischen ihr und der Rückplatte. Dies führt zu einer Spannungsänderung (dem elektrischen Signal) und dient zur Schallerfassung.
Ein Bändchenmikrofon ist im Wesentlichen ein dynamisches Mikrofon, bei dem anstelle einer beweglichen Spule (die in einem starken Magnetfeld aufgehängt ist) ein sehr dünner Metallstreifen (Bändchen) verwendet wird. Bändchenmikrofone bieten die gleiche Empfindlichkeit wie Kondensatormikrofone, haben aber einen ganz anderen, ausgeprägteren Charakter.
Die Membrangröße (Kondensatormikrofone)
[Hinweis: Denken Sie an einen guten „Größe ist wichtig“-Witz und fügen Sie ihn später ein]
Wenn Sie nach einem Kondensatormikrofon für das Hauptstudio suchen, mit dem Sie Gesang und Ähnliches aufnehmen können, wird Ihnen wahrscheinlich ein Mikrofon mit großer Membran angeboten.
Generell gilt jedes Kondensatormikrofon mit einer Membran mit einem Durchmesser von mehr als 2,5 cm als groß. Alles darunter gilt als Kleinmembran, und in diesem Fall handelt es sich wahrscheinlich um ein Stäbchenmikrofon. Beide haben je nach Situation ihre Stärken und Schwächen.
Frequenzgang
Der im Datenblatt angegebene Hz-Bereich sollte Sie genau über die niedrigsten und höchsten Frequenzen informieren, die das Mikrofon erfassen und aufzeichnen kann. Ein Bereich von 20 Hz bis 20.000 Hz deckt praktisch alles ab, was das menschliche Ohr hören und genießen kann.
Wenn Sie den Kauf eines neuen Mikrofons in Erwägung ziehen, sollten Sie auch einen Blick auf das Frequenzdiagramm werfen. Es gibt Aufschluss darüber, wie das Mikrofon auf tiefe, mittlere und hohe Frequenzen reagiert und welche Frequenzen im Klang dominieren.
Stellen Sie es sich wie die kleingedruckte Beschreibung auf Ihrer Weinflasche vor, die Ihnen Hinweise auf den Geschmack gibt. Die nahezu flache Linie bedeutet, dass das Mikrofon kaum bis gar keine Verfärbungen aufweist und sehr präzise, natürliche Aufnahmen erzeugen kann.
Maximaler Schalldruckpegel
Die Angabe des maximalen Schalldruckpegels (SPL) gibt an, wie laut das jeweilige Mikrofon sein Signal maximal verarbeiten kann, ohne es zu verzerren. Alles über 120 dB sollte mehr als ausreichend sein, wenn Sie nicht gerade die Explosion eines alten Sterns aus nächster Nähe aufnehmen möchten.
Bei der Überprüfung eines bestimmten Mikrofons ist es wichtig, den Schalldruckpegel zu ermitteln, bei dem die sogenannte Gesamtverzerrung (THD) auftritt. Vereinfacht ausgedrückt handelt es sich dabei um die geringfügige Veränderung des aufgenommenen Audiosignals im Vergleich zur Schallquelle.
Es wird normalerweise (wenn überhaupt) als THD von 1 % oder sogar nur 0,5 % (weniger ist besser) dargestellt und bedeutet, dass bei diesem bestimmten Schalldruckpegel ein sehr kleiner THD auftritt, der hörbar ist.
Der maximale Schalldruckpegel des BH1 von JZ Microphones beträgt 134,5 dB SPL (2,5 kΩ, 0,5 % THD).
Rauschpegel (Eigenrauschen) und Signal-Rausch-Verhältnis
Das Maß für die Lautstärke des Mikrofons. Da es sich bei einem Mikrofon um ein relativ komplexes elektrisches Gerät handelt, das in einer bestimmten Umgebung eingesetzt wird, gibt es zwangsläufig Geräusche ab. Je weniger Geräusche es erzeugt, desto besser.
Ein Geräuschpegel von unter 20 dB-A ist sehr gut, alles unter 15 dB-A ist hervorragend und bedeutet wahrscheinlich, dass Sie ein Studiomikrofon der Premiumklasse vor sich haben.
Das Signal-Rausch-Verhältnis ist eine weitere Möglichkeit, auszudrücken, wie laut (oder leise) das Mikrofon ist. Der angezeigte dB-Pegel gibt genau an, wie viel lauter das Signal im Vergleich zum Eigenrauschen ist.
Abschluss:
Die oben genannten technischen Daten unterscheiden ein gutes von einem schlechten Mikrofon und sind ein guter Ausgangspunkt, um herauszufinden, ob es sich überhaupt lohnt, das Produkt näher zu untersuchen.
Das Wichtigste beim Kauf eines Mikrofons ist jedoch, zu wissen, für welche Art von Arbeit Sie es verwenden möchten.
Wenn Sie sich entschieden haben, in ein Mikrofon zu investieren, sollten Sie es vermeiden, in Geschäften herumzustöbern und etwas auszuwählen, das Ihre Aufmerksamkeit in einem bestimmten Moment erregt hat.
Erstellen Sie stattdessen eine Liste der wichtigsten Faktoren: Nutzen Sie das Mikrofon als Allround-Aufnahmegerät? Wird es ein Gesangsmikrofon sein? Ein Gitarrenmikrofon? Machen Sie nur Radio oder Voiceover? Nehmen Sie verschiedene Stimmungen für einen Film auf?
Die Klangwahrnehmung ist sehr subjektiv. Daher ist es wichtig, alles zu tun, um den Klang in Ihrem Kopf für eine bestimmte Anwendung mit dem Klang abzugleichen, der vom verwendeten Mikrofon wiedergegeben wird.